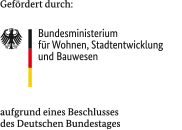Zwischen Monarchie, Diktatur und Demokratie
Die Karl Bösch-Biografie von Walter Baumfalk

Die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts führt unweigerlich zur Konfrontation mit der Zeit des Nationalsozialismus – auch in der Kunstgeschichte, nicht zuletzt auf regionaler Ebene. Dieser Aufgabe hat sich Walter Baumfalk, ehemaliger Vizepräsident des Amtsgerichts Aurich und Autor des Lexikons ostfriesischer Künstler, gestellt. Zu Beginn der 2020er Jahre begann er mit der Arbeit an einer Biographie des Wittmunder Künstlers Karl Bösch.[1]
Karl Bösch gehörte in einer Zeit, in der es noch nicht die heutige Vielfalt an regionalen Künstlern gab, zu den bedeutendsten Landschaftsmalern Ostfrieslands. Walter Baumfalk beschreibt sein Lebenswerk in dem Buch Karl Bösch – Maler Lehrer Soldat als „durch die Kaiserzeit geprägt […]. Er beschäftigt sich ausschließlich mit den traditionellen ,klassischen Bildmotiven‘, besonders mit der Landschaft in einfacher direkter Abbildung, stets eine ,heile Welt‘ darstellend und er hat so – besonders als ,Maler Wittmunds‘, als Maler der ostfriesischen Landschaft - ein umfangreiches Werk geschaffen.“[2] Im Untertitel des Buches deutet Walter Baumfalk die Problematik der Auseinandersetzung mit dem Künstler Karl Bösch an: „Ein Leben als Künstler im Umbruch der Zeitepochen“.
Ein bewegtes Leben
Karl Bösch wurde 1883 in Bremerhaven als drittes Kind des Soldaten Johann Jakob Bösch und seiner Frau Eleonore geboren. 1889 zog die Familie nach Wittmund, wo der Vater nach seiner Dienstzeit eine Stelle als Hilfsvollziehungsbeamter der Stadtkasse übernahm. 1897 erfolgte die Versetzung nach Düsseldorf, wo er als Zollaufseher tätig wurde.
Der künstlerisch begabte Sohn beendete seine Schulzeit mit der mittleren Reife („Einjähriges“) und begann 1901 ein Studium an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf. Drei Jahre später legte er die Prüfung als Zeichenlehrer-Aspirant ab, wie ein im Buch wiedergegebenes Zeugnis belegt. In diese Zeit fiel auch sein Wehrdienst, den er als Reserveoffizier abschloss – eine prägende Entwicklungsstufe seiner Persönlichkeit, wie Baumfalk hervorhebt.
Mit 21 Jahren verfügte Bösch über die Lehrbefähigung für verschiedene Schulstufen und trat Anfang 1905 eine Stelle als Kunsterzieher in Siegen an, die er bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 innehatte. Den Krieg erlebte er als Offizier in einem bayerischen Reserve-Infanterie-Regiment, bis er 1917 schwer verwundet wurde. Da ihm die Verletzung eine Rückkehr in den Schuldienst unmöglich machte, schied er aus dem Lehrberuf aus.
Nach einem kurzen Aufenthalt in München kehrte Bösch 1920 nach Wittmund zurück. Dort konnte er mit seiner Ehefrau in das elterliche Haus in der Osterstraße einziehen, das nicht verkauft worden war. Sein Vater war bereits 1914 in den Ruhestand getreten und ebenfalls nach Wittmund zurückgekehrt.
In dieser Zeit entwickelte sich Karl Bösch vom Zeichenlehrer zum freischaffenden Künstler und Grafiker. Zugleich engagierte er sich politisch als Kreisvorsitzender des Stahlhelms, des Bundes der Frontsoldaten. Der überzeugte und begeisterte Soldat war 1920 dem ein Jahr zuvor in Magdeburg gegründeten Verband beigetreten und hatte in Wittmund sofort die Leitung übernommen.
An diesem Punkt seines Lebenswegs zeigt sich ein Muster, das für viele Biographien in Deutschland bis 1945 prägend war: Der von Walter Baumfalk beschriebene „Umbruch der Zeitepochen“ stellte die bisherigen politischen und moralischen Maßstäbe auf den Kopf. In der Unübersichtlichkeit und chaotischen Dynamik dieser Jahre sahen sich viele Menschen mit erheblichen Orientierungsproblemen konfrontiert.
Der Umbruch der Epoche
Für die 14 Jahre zwischen der Ausrufung der Weimarer Republik und der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 stößt der Kunsthistoriker auf ein zentrales Problem seiner Forschung: die unzureichende Quellenlage. „Äußerungen von Karl Bösch zu seinen Beweggründen, dem Stahlhelm beizutreten und auch Leitungsfunktionen zu übernehmen, sind nicht bekannt.“[3] Immer wieder ist Baumfalk gezwungen, auf spärliche Hinweise zurückzugreifen, wenn er die Entwicklung und den Aufstieg des Stahlhelm in Deutschland – und speziell in Ostfriesland und Wittmund – nachzeichnet. Um diese Lücken zu füllen, widmet er sich in einem eigenen Beitrag ausführlich der Darstellung des historischen Hintergrunds.
Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung zählte der Stahlhelm im Reichsgebiet rund 500.000 Mitglieder. In Wittmund waren es etwa 125 sogenannte Stahlhelmer sowie 25 Jung-Stahlhelmer. Der Bund setzte sich aus Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs zusammen, die in den unruhigen Anfangsjahren der Republik einerseits für „Ruhe und Ordnung“ eintraten, andererseits jedoch die Abschaffung der Demokratie verfolgten: „Dieser Zusammenschluss nationalgesinnter Soldaten beherrschte das gesamte gesellschaftliche Leben im Landkreis und leistete gründliche Vorarbeit für den Untergang der Demokratie.“ [4]
Der Aufstieg des Stahlhelms in Ostfriesland – etwa in Emden[5], Aurich, Jever und Wittmund – trug maßgeblich dazu bei, die Legitimität der jungen Weimarer Demokratie zu untergraben und letztlich der NSDAP den Weg zu ebnen. Unterstützung erhielt der Verband dabei von den ihm nahestehenden Parteien DDP und DNVP, die sowohl auf Reichsebene als auch in den kommunalen und regionalen Parlamenten Einfluss nahmen. In welchem Umfang die örtlichen Erfolge des Bundes auf das Wirken des Wittmunder Ortsvorsitzenden Karl Bösch zurückzuführen sind, lässt sich aufgrund der dürftigen Quellenlage nicht eindeutig belegen, sondern nur vermuten. Bösch hatte den Vorsitz 1921 übernommen und legte ihn 1927 nieder, als er für ein Gewerbelehrer-Studium nach Berlin ging, wo er bis 1929 verblieb.
Eine Region im Übergang
Mitte der 1920er Jahre vollzog der Stahlhelm einen entscheidenden politischen Wandel: Aus einer zunächst sozial-fürsorglich geprägten, wenn auch erzreaktionären Vereinigung entwickelte er sich zu einem entschlossenen Akteur auf der politischen Bühne des Reiches. [6] Ende des Jahrzehnts initiierte der Verband ein Volksbegehren gegen den sogenannten Young-Plan und schloss sich kurz darauf gemeinsam mit anderen rechtsextremen Parteien, darunter auch die NSDAP, zur Harzburger Front zusammen. In Wittmund erreichte der Stahlhelm 1929 bei einem Volksbegehren zur Auflösung des preußischen Landtages eine Zustimmung von 62,8 Prozent. [7] Innerhalb der Organisation war diesem Bündnis mit den Nationalsozialisten ein heftiger Richtungsstreit vorausgegangen: Der Oldenburg-Ostfriesland-Teil sprach sich zunächst gegen eine Zusammenarbeit aus, konnte sich der späteren Gleichschaltung jedoch nicht mehr widersetzen.
Über Karl Böschs Rückkehr nach Wittmund hält Baumfalk sachlich fest, dass er sich nicht mehr öffentlich wahrnehmbar in die Angelegenheiten des Bundes einmischte.
Der Künstler Karl Bösch machte in den 1930er Jahren zunächst eine kurze Karriere an der Wittmunder Berufsschule. Nach wiederholten Auseinandersetzungen mit der Schulbehörde wurde er jedoch zwangspensioniert. Erst nach dem Krieg, im Zuge der Entnazifizierung, erhielt er erneut eine Anstellung und übernahm die Leitung der Berufsschule Wittmund. Doch auch in dieser Position holte ihn seine Vergangenheit als aktiver Funktionär des Stahlhelms ein: Die alliierte Behörde enthob ihn vorübergehend wieder seines Amtes. Sein Biograf zitiert dazu Böschs Aussagen vor dem Entnazifizierungsausschuss. „Ich bin Soldat gewesen […]. Beseelt von dem festen Willen, tatkräftig am Aufbau des Neuen Staates, der Republik, nach dem Zusammenbruch vom 9. November 1918 mitzuwirken“, habe er sich 1921 an der Gründung des Stahlhelms in Wittmund beteiligt.“[8] Baumfalk kommentiert dies kritisch: „Der Stahlhelm stand allerdings der Weimarer Republik ablehnend gegenüber. Karl Bösch spielt hier seine damalige Einstellung stark herunter.“ [9] Im Oktober 1946 wird er wieder als Leiter der Berufsschule eingesetzt und nach zwei Jahren in den Ruhestand versetzt. 1952 stirbt Bösch in Wittmund.
Künstlerisch, so stellt sein Biograf klar heraus, vermied Bösch es, sich den volkstümelnden, völkischen oder heimatkünstlerischen Vorlieben der Machthaber anzupassen. Er blieb seinem Stil treu, den Baumfalk als post-impressionistischen Realismus beschreibt, [10] und bewahrte sich damit das Profil des Landschaftsmalers, für das er bekannt war. Ob man Baumfalks vorsichtiger Einschätzung folgen möchte, dies zugleich als bewussten Verzicht auf eine politische Positionierung zu deuten, sei dahingestellt. Angesichts der repressiven Grundhaltung jener Zeit könnte dies jedoch durchaus ein handlungsleitendes Motiv gewesen sein.
Bilanz eines Künstlerlebens
Zum Werk Karl Böschs zählen zahlreiche Darstellungen ostfriesischer Baudenkmäler, darunter die Peldemühle in Wittmund, verschiedene Stadtansichten sowie markante Landschaftsmotive aus allen Teilen Ostfrieslands. Als er 1952 in Wittmund verstarb, galt er als angesehener Bürger der Stadt und als der bedeutendste Maler der Harlingerland-Region seiner Zeit. Auch als Grafiker hinterließ er bleibende Spuren: In den 1920er Jahren entwarf er das bis heute gültige Stadtwappen Wittmunds. Im öffentlichen Raum ist er zudem mit dem Kriegerdenkmal auf dem Wittmunder Friedhof präsent, das noch in einem stark konventionellen Stil des wilhelminischen Erinnerungsverständnisses gestaltet ist.
Es ist Walter Baumfalk zu verdanken, dass er sich der schwierigen Aufgabe gestellt hat, eine Künstlerbiografie im Spannungsfeld der politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts zu verfassen. Bereits 2016, anlässlich der Eröffnung einer Karl-Bösch-Ausstellung in Wittmund, [11] wies er in seiner Rede auf die besondere politische Problemlage des Künstlers hin und machte deren Tragweite deutlich. Knapp zehn Jahre später – inmitten einer erneut unübersichtlichen politischen Weltlage – ist es ein Gewinn für kunstinteressierte Leserinnen und Leser, diese Zusammenhänge offen und transparent dargelegt zu bekommen.
Walter Baumfalk: Karl Bösch 1883 – 1952. Maler - Lehrer - Soldat - Ein Leben als Künstler im Umbruch der Zeitepochen. Oldenburg 2023 (Isensee Verlag, 186 Seiten, 29 €)
© Walter Ruß
[1] Baumfalk, Walter: Karl Bösch.1883-1952. Maler – Lehrer – Soldat. Ein Leben als Künstler im Umbruch der Zeitepochen. Oldenburg 2022.
[2] Ebenda. S. 156.
[3] A.a.O. S. 76: In seinen Einlassungen vor dem Entnazifizierungsausschuss 1946 gibt Bösch dazu eine Erklärung ab, die ihre Wirkung nicht verfehlt. S.a. Anmerkung 9.
[4] Inge Lüpke-Müller: a.a.O. S. 19.
[5] Vgl. Dietmar von Reeden: Ostfriesland zwischen Weimar und Bonn. Eine Fallstudie zum Problem der historischen Kontinuität am Beispiel der Städte Aurich und Emden. Hildesheim 1991. Ebenso ders.: National oder nationalistisch? Eine Fallstudie zum Verhältnis von Stahlhelm und NSDAP in Emden 1932 bis 1935. In: Ostfriesland zwischen Monarchie und Diktatur. S. 201ff.
[6] Vgl dazu: Dennis Werberg: Der Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten. Eine Veteranenorganisation und ich Verhältnis zum Nationalsozialismus. Berlin/Boston 2023. Und: Volker R. Berghahn: Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten 1918 – 1935. Düsseldorf 1966.
[7] Inge Lüpke-Müller. a.a.O. S. 35.
[8] Karl Bösch. A.a.O. S. 141.
[9] Ebenda.
[10] Walter Baumfalk: a.a.O. S. 26.
[11] Stadtarchiv Wittmund. Akte Karl Bösch